|
|
| |
Mai
2005: |
| |
| |
Endlich
sind die 30 Bäume oberhalb der Albula-Straße fertig. Immerhin
haben die großen Bäume bis zu 90 Äste – bis zu
2,5 Stunden dauert die Belaubung von so einem Baum. Ein bisserl individuell
sollen's schon ausschauen, schliesslich sehen die Bäume in der
Natur auch kaum aus wie von der Stange – wobei man bei Fichtenmonokulturen
schon mal seine Zweifel bekommen kann. Wie auch immer –ich finde,
die langwierige Arbeit hat sich gelohnt. Eine neue Erfahrung für
mich ist, auch ganz kleine Nadelbäume als Modelle nachzubilden.
Meist sieht man auf Modellanlagen groß konfektionierte Bäume
– bildet man nun auch kleine Bäumchen, etwa in Preiser-Männchen-Größe
nach, wirkt die Modellnatur gleich viel authentischer. Besonders reizvoll
wirken Kontraste wie große und kleine Bäume, Wald und lockere
Baumgruppen oder einzelstehende Bäume und ganz eng zusammenstehende
Bäume, deren Kronen von weitem wie eine einzige Silhouette erscheinen.
Durch den von der Albula-Straße abzweigenden Feldweg und dessen
Kreuzung mit dem Wanderweg ergeben sich schöne Blicke aus diversen
Perspektiven durch die Bäume – im Original ebenso wie im
Modell. |
|
 |
| |
|
|
zur
Galerie |
| |
| |
März/April
2005: |
| |
| |
Es
geht mir beim Bau dieser Albula-Brücke auch darum, die Landschaft
im Modell wiedererkennbar nachzubilden. Vorbildfotos leisten mir Hilfe
beim Bau der Bäume und deren Aufstellung im Gelände, was
nicht ganz einfach ist, denn die Perspektiven zwischen Modell und
Vorbild sind nicht ohne weiteres unter einen Hut zu bringen. Vor allem
musste ich mal einsehen, daß die Bäume wesentlich schlanker
zu gestalten sind, als gewohnt. |
|
 |
| |
| |
Beim Aufstellen
der Baumrohlinge (Zitat eines Besuchers: schaut aus wie Waldsterben)
wurde gleich klar, daß ich manches verkürzt darstellen
muss, weil der Platz in der Tiefe fehlt. Trotzdem scheint mir schon
jetzt, in der Phase "Waldsterben", der Eindruck könnte
nach der Begrünung dem Vorbild ziemlich nahe kommen. Mir geht
es um gewisse Durchblicke und Perspektiven, die mir gefielen beim
Wandern durch das Albulatal.
Löten der
Rohlinge und Stellproben für die Bewaldung gestalten sich unerwartet
langwierig. Allein auf der kleinen Fläche oberhalb der Straße
stehen jetzt schon 30 Bäume. Ich schätze, daß das
Albula-II-Modul auf einer Fläche von 150 x 50 cm insgesamt
mehr als 100 Bäume erhalten wird.
|
|
 |
| |
| |
Beim
Durchsehen der Dias hat es mich doch gewurmt, daß der Platz
nördlich der Brücke recht knapp bemessen ist auf meinem
Modul. Diese Situation mit dem Weg durch das Wäldchen sollte
doch mit auf die Anlage. Auf den folgenden beiden Bildern mit den
Drahtmodellen sieht man, was mir einfach nicht gefallen wollte: zwar
hatte ich einen Baum nachgebildet mit Ästen bis fast zum Boden,
jedoch der besondere Charme des Durchblickes und der Wanderweg-Markierung
am Baumstamm – es musste einfach noch mit einbezogen werden.
Also habe ich noch die beiden hinteren, nahe beieinanderstehenden
Bäume gelötet und gedrillt. Einfach mal sehen, ob sich mit
"Schiebung" was machen lässt, notfalls könnte
ich die Bäume auch anderweitig auf der Anlage verwenden. |
|
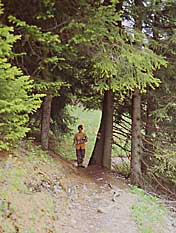 |
| |
| |
So hat die Chose
im Drahtmodell-Zustand zunächst ausgesehen.
By the Way -
heute beim Wandern ist mir aufgefallen, daß Tannenzapfen,
wenn sie von Eichkatzerl auseinandergezupft sind, eine schöne
Farbe für Waldboden ergeben könnten. Also werde ich mal
reife Tannenzapfen mahlen …
|
|
 |
| |
| |
Auch
die Wurzeln auf dem Wanderweg sollen nachgebildet werden. Sowas ist
typisch für Wanderwege im Gebirge - abgetretene Wurzeln an der
Bodenoberfläche. Übrigens habe ich mir eingebildet, nach
dem Abtauen des Schnees etwas Lärchenwaldboden einsammeln, trocknen
und mahlen zu können. Pfeifendeckel, denn von den Nadeln ist
nach einem Winter nurmehr wenig übrig. Am besten sammelt man
Naturmaterialien aus Wäldern mit laubabwerfenden Bäumen
im Herbst, denn dann ist alles frisch, vor allem die Farben. |
|
 |
| |
| |
Die nächsten
beiden Galerie-Bilder zeigen also die drei Bäume, die ich wichtig
finde, um den Eindruck der Vorbildsituation annähernd wiederzugeben.
Die Begrünung
der Baumgerippe und somit der Fortschritt der Arbeiten an der Anlage
richtet sich nunmehr, ab April, nach den Erfordernissen der Gartenarbeiten
draußen vor der Haustüre. Ausserdem werde ich wohl erstmal
eine Anlagenbeleuchtung anbringen, denn die ersten begrünten
Koniferen zeigen – es wird dunkel im hinteren Anlagenbereich.
Und nicht zu vergessen – die Wandersaison beginnt, somit auch
einige "Studien" am Vorbild – mich bizzelt halt doch
eine spezielle RhB-Brücke. Daher wird der Modellteil dieser
Site über das Sommerhalbjahr vermutlich nicht oft aktualisiert,
Vorbildbilder allerdings habe ich en masse. Aber die kommende Intensiv-Modellbahn-Saison
kommt sicher ...
|
|
 |
| |
|
|
zur
Galerie |
| |
| |
2004: |
| |
| |
Zum
möglichst originalgetreuen und maßstäblichen Nachbau
der Brücke war das Buch "Technische Bauten schmalspuriger
Gebirgsbahnen" von Schweers und Wall hilfreich. Selbstverständlich
war noch das Fotografieren verschiedenster Details nötig, wie
etwa die Schutzmauer vor Unterspülungen am Hauptbogen-Pfeiler
oder die kleinen, etwas versteckt liegenden Zugänge an die Pfeilerfundamente.
Die Hauptabmessungen wurden auf 10mm Pappelsperrholz aufgezeichnet.
Zum Aussägen habe ich zwei Sperrholzplatten übereinander
gelegt. |
|
 |
|
| |
Und
dann "nur" noch zusammenleimen. Zuvor allerdings gab es
noch etliche Zwischenstücke, beidseitig oben enger werdend, zu
sägen. Die Pfeiler werden schliesslich zum Fundament hin breiter.
Ohne präzise Tischkreissäge kaum exakt zu bewältigen.
Einfach auf ein paar Fahrzeuge verzichten. Es gibt recht gute Sägen
(mit Werkstatt-Staubsauger) schon zum Preis von 3 oder 4 Bemo-Normalserien-Lokis.
– Nicht vergessen beim Planen: Es muss ja noch mindestens 2mm
Gips allseitig aufgetragen werden. |
|
 |
|
| |
Ich habe mich
dazu entschlossen, die Brücke so zu bauen, daß die Pfeiler
unten keine Chance haben, sich beim Gipsen zu verziehen. Am Fundament
habe ich durchgehend noch einige Zentimeter Holz stehen lassen.
Das gibt der Brücke insgesamt eine gute Stabilität. So
schaut das Ganze am Ende aus wie ein Kasten und ist nach allen Richtungen
hin verwindungssteif. Also kann die Feuchtigkeit des Gips dem Brückenrohling
kaum etwas anhaben.
Zum Gipsen sind
Kartonschblonen empfehlenswert, denn sie ermöglichen exakte
Konturen. Ich habe zu diesem Zweck einen schweren Aquarellkarton
genommen, den kann man sogar mehrmals verwenden.
|
|
 |
|
| |
Etwas
für Alchimisten: Nach schlechten Erfahrungen bei Versuchsstücken
habe ich eine Rezeptur ausgetüftelt in der Hoffnung, daß
sie nicht so hart und spröde wie Gips ist. Dem Gips habe ich
etwa ein Viertel Moltofill beigegeben. Vor dem Auftrag des Gipses
auf das Holz hat es sich bewährt, es mit Holzleim einzupinseln.
Sobald der Leim etwas angezogen hat, kann man die Mischung auftragen.
Diese ist mit Leimwasser angerührt. Um Stein-Struktur zu erhalten,
abschliessend mit einem Borstenpinsel Gemisch aufstupfen. Zu diesem
Zweck habe ich ein Leimwasser mit hohem Leimanteil zubereitet. Dem
möglichen Abplatzen beim Steinritzen kann vor dem Stupfen noch
dadurch vorbeugend begegnet werden, indem man die glatte Gipsoberfläche
etwa mit einer alten Holzraspel behutsam anrauht. Vor dem Stupfen
leimen ist nicht empfehlenswert, falls man später mit Aquarellfarbe
einfärben möchte, denn beim Ritzen kommt man garantiert
stellenweise auf diese Leimschicht. Die stösst Wasser ab und
es hilft auch keine Ochsengalle mehr als Netzmittel. |
|
 |
|
| |
O.K.
und dann geht das Fugenritzen los. Bei einer Brücke dieser Größe
dauert das schon ein bisserl. Für die Bogenmauerung fertigte
ich eine Schablone. Einige Fotos halfen mir beim nächsten Schritt:
Steine einer Bogen-Mauerung zählen, um annähernd maßstabgetreue
Steingrößen zu erhalten. Ich habe nun nicht jeden Stein
exakt wie beim Vorbild geritzt - mir kam es aber darauf an, daß
später alles stimmig wirkt. Es gibt so einige Kleinigkeiten,
wie z. B. die drei rötlich gefärbten Steine im Bogen auf
der Südseite, gleich dort, wo der Wanderweg verläuft und
die Wanderwegmarkierung angebracht ist. Bei sowas darf man ruhig "kleinlich"
sein, denn das sind die Details, welche die Wiedererkennbarkeit ausmachen.
Der Rest bleibt dann wieder der Routine oder der "schöpferischen
Freiheit" überlassen. |
|
 |
|
| |
Vom
Einfärben des Brückenmodells gibt es keine Bilder. Doch
einige Tipps an dieser Stelle: Grundsätzlich färbe ich den
Gips mit Aquarellfarbe der Firma Schmincke. Dabei achte ich auf Lichtbeständigkeit
der höchsten Klassen, was bei Erdfarb-Tönen wie Goldocker,
Umbra gebrannt und natur sowie Elfenbeinschwarz (dies Schwarz ergibt
einen schönen warmen Ton) gegeben ist. Alle Farben werden mit
viel Wasser in kleinen Marmeladegläsern verdünnt und für
die Zeit des Färbens darin aufbewahrt. Ochsengalle als Netzmittel
nicht zu vergessen. |
|
 |
|
| |
Die
menschliche Haut gibt immer geringe Mengen Fett ab und beim Steineritzen
überträgt sich dieses auf gewisse Stellen. Vorwiegend an
Mauerkanten. Also pinsle ich den Gips vor dem Farbauftrag mit Isopropanol
ab und löse somit alles, was Aquarellfarbe abweist. Es werden
keine Mischfarben aufgetragen, dafür jeder Ton für sich
extra. Je stärker die Farbe verdünnt ist, desto besser lässt
sich in schichtweisem Auftrag der Ton mit feinen Lasuren steuern.
Ein paar Originalsteine aus der Umgebung der Brücke dienen als
"Farbkarte". Man kommt mit den genannten 4 Farbtönen
absolut dem Original nahe. Auf jeden Fall an Gipsabgüssen testen.
Es gibt übrigens Unterschiede bei der Farbaufnahme je nach gespachteltem,
gestupftem – und besonders bei gegossenem Gips auf der Rückseite
und der Seite, die in der Latexform war. |
|
 |
|
| |
Die
Mauer-Ritzen werden nach Durchtrocknung der Brücke zunächst
leicht gewässert und dann mit einem spitzen Aquarellpinsel verdünnte
weiße Acrylfarbe einlaufen gelassen. Die Kalkspuren und was
sonst noch an den Innenseiten der Bögen an Sauce runtersickern
mag, habe ich mit meinem verdünntem Spezial-Gips-Gemisch nachgebildet.
Im Original sind diese Spuren ja auch teilweise erhaben auf dem Mauerwerk.
Stellenweise mit verdünntem Goldocker und Umbra natur einpinseln
und schon schauts aus wie echt. Ich denke, es sind nicht nur Kalkspuren,
was da runtersickert, vermutlich auch Reste Allzumenschliches und
das ist nicht weiß. |
|
 |
|
| |
Nun
erst wird die Brücke in den Modulkasten eingebaut. In diesem
Falle leicht diagonal, damit's nicht zu starr wirkt. Immerhin ist
das Modell ca. 115 cm lang und der Modulkasten "nur" 50
cm breit. Also hats vergleichsweise wenig Gelände um die große
Brücke herum. Anschliessend habe ich auf verschiedenen Ebenen
Auflageflächen für die Styrodur-Blöcke eingepasst.
Ich wollte nicht den ganzen Modulkasten mit dem teuren Material auffüllen.
Kabelverbindungen nicht vergessen, denn die lassen sich nachträglich
bei dieser Methode nurmehr schwer einziehen. Das Gelände wurde
mittels etlicher Fotos dem Original nachgebildet. Zum Glück gibt's
mit Styrodur nicht das fürchterliche Gekrümel wie mit Styropor.
Unter dem Brückenmodul hat es einen Leichtbau
Grundrahmen – dieser ist aus optischen Gründen
zurückgesetzt und von vorn bei normaler Betrachtungsperspektive
nicht sichtbar. Insgesamt könnte vom Gewicht her eine Person
dieses Modul alleine mit Leichtigkeit tragen, wenns nicht so sperrig
wäre. |
|
 |
|
| |
Und
schon samma wieder bei den Rezepturen – mein Gemisch für
die Geländehaut: 2 Eßlöffel Gips, 4 Eßlöffel
Moltofill und 2/3 Gipsanrühr-Gummibecher mit Sägestaub.
Diesen Sägestaub fange ich in meiner Kreissäge-Absaugung
auf, das Kreissägeblatt hat bei 250mm Durchmesser 80 Zähne.
Ein gröberes Blatt zerfetzt das Holz eher als daß es feine
Schnitte macht, und es liefert das bekannte grobe Sägemehl und
nicht den feineren Sägestaub. Also das Ganze mit Leim-Wasser
sämig anrühren und draufgeklatscht auf's Styrodur. 2 –
3 mm Auftrag genügen. Ganz ohne Farbzugabe ergibt das einen schönen
natürlichen Farbton und vor allem kann man einerseits eine schöne
körnig krümelige Struktur haben – eben wie echte Erde
en Miniature – andereseits, wenn man oft genug mit einem Malerspachtel
drüberstreicht, auch eine ziemlich glatte Oberfläche. Für
die Straße fertigte ich ein Gemisch mit weniger Sägestaub
und mehr Gipsanteil. |
|
 |
|
| |
Zuvor allerdings
galt es noch einige Details zu fertigen und anzubringen. So zum
Beispiel den ummauerten Abfluß neben der Straße unterhalb
des Wanderweges. Oder die Stützmauer an der Straße und
die Schutzmauer vor Unterspülungen des Fundamentes am Pfeiler
unterhalb der Straße. Natürlich nicht zu vergessen die
beiden kleinen Gehäuse auf der Nordseite der Hauptpfeiler mit
den Zugangstüren zu den Fundamenten. Das Bachbett ist ausgefüllt
mit Albulabach-Steinchen und Sand aus der Nähe des Campingplatzes
Bergün.
Das Brückengeländer
sowie die Oberleitungs-Brückenmasten sind bereits gelötet.
Bevor ich diese Teile jedoch einbaue, muss erst das Gleis angelötet,
verlegt und eingeschottert werden. Einige Baumgerippe sind ebenfalls
schon nach Orginalfotos gelötet.
Fortsetzung
folgt ...
|
|
 |
| |
nach
oben |
|
zur
Galerie |
|



