Sokrates
469—399 v. Chr. Sohn des Steinmetzen Sophroniskos und der Hebamme Phainarete. Aus Alopeke (Attika).
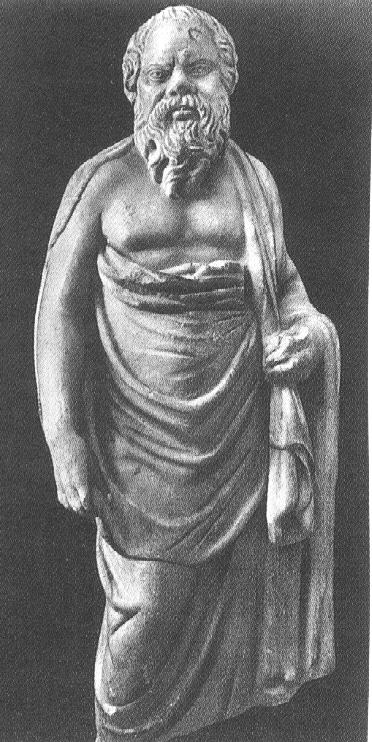 Sokrates wird übereinstimmend als häßlich
bezeichnet; er habe einem Silen geglichen, von untersetzter Gestalt, mit Bauch,
Glatze, dickem Hals, vorquellenden Augen, aufgestülpter Nase und großem Mund mit dicken
Lippen. Er entsprach also keineswegs dem Ideal der Zeit, und — was damals wohl
überraschend war — sein Äußeres entsprach nicht der <Schönheit seiner
Seele>. Durch zwei inschriftlich beglaubigte Hermen ist das Sokrates-Bildnis gut
überliefert, eine Doppelherme mit Seneca und eine Herme in Neapel. Danach lassen sich
andere Köpfe als Bildnisse des Sokrates erkennen. Dabei zeigt sich, daß zwei
unterschiedliche Originale kopiert worden sind. Das erste ist offenbar entstanden, als der
Künstler noch Gelegenheit hatte, Sokrates zu sehen. Hier erscheint der Philosoph ganz
nüchtern erfaßt, durchaus satyrhaft, aber doch in einer Art, die seine Weisheit hinter
der häßlichen Maske deutlich erkennen läßt. Das zweite Sokrates-Bildnis entstand auf
dieser Grundlage erst nach seinem Tode und ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit jenem
<Reuebildnis>, das die Athener, nachdem sie ihn zum Tode durch den Giftbecher
verurteilt hatten, als Wiedergutmachung aufstellten. Es war ein Werk des Lysippos (Diog.
I.aerr. 2,43; Tert. Apol. 14). Dieses Bildnis glorifiziert den zu Unrecht verurteilten
Philosophen und zeigt ihn so, wie ihn auch seine Schüler sahen. Der Künstler verdrängte
das Häßliche zugunsten einer geistigen Schönheit des Mannes, der lehrte, daß die
Tugend lernbar sei, und der von sich bekannte, daß er nichts wüßte. Als einsamen Mann
in seiner Zeit, nicht nur von seiner Frau Xanthippe unverstanden, arm und anspruchslos,
zeigt ihn das frühe Bildnis; den Philosophen, der verkündete: «Es gibt nur einen Gott,
die Kenntnis, und nur einen Teufel, die Unkenntnis», und der dem Individuum befahl, nur
auf die eigene innere Stimme zu hören [...].
Sokrates wird übereinstimmend als häßlich
bezeichnet; er habe einem Silen geglichen, von untersetzter Gestalt, mit Bauch,
Glatze, dickem Hals, vorquellenden Augen, aufgestülpter Nase und großem Mund mit dicken
Lippen. Er entsprach also keineswegs dem Ideal der Zeit, und — was damals wohl
überraschend war — sein Äußeres entsprach nicht der <Schönheit seiner
Seele>. Durch zwei inschriftlich beglaubigte Hermen ist das Sokrates-Bildnis gut
überliefert, eine Doppelherme mit Seneca und eine Herme in Neapel. Danach lassen sich
andere Köpfe als Bildnisse des Sokrates erkennen. Dabei zeigt sich, daß zwei
unterschiedliche Originale kopiert worden sind. Das erste ist offenbar entstanden, als der
Künstler noch Gelegenheit hatte, Sokrates zu sehen. Hier erscheint der Philosoph ganz
nüchtern erfaßt, durchaus satyrhaft, aber doch in einer Art, die seine Weisheit hinter
der häßlichen Maske deutlich erkennen läßt. Das zweite Sokrates-Bildnis entstand auf
dieser Grundlage erst nach seinem Tode und ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit jenem
<Reuebildnis>, das die Athener, nachdem sie ihn zum Tode durch den Giftbecher
verurteilt hatten, als Wiedergutmachung aufstellten. Es war ein Werk des Lysippos (Diog.
I.aerr. 2,43; Tert. Apol. 14). Dieses Bildnis glorifiziert den zu Unrecht verurteilten
Philosophen und zeigt ihn so, wie ihn auch seine Schüler sahen. Der Künstler verdrängte
das Häßliche zugunsten einer geistigen Schönheit des Mannes, der lehrte, daß die
Tugend lernbar sei, und der von sich bekannte, daß er nichts wüßte. Als einsamen Mann
in seiner Zeit, nicht nur von seiner Frau Xanthippe unverstanden, arm und anspruchslos,
zeigt ihn das frühe Bildnis; den Philosophen, der verkündete: «Es gibt nur einen Gott,
die Kenntnis, und nur einen Teufel, die Unkenntnis», und der dem Individuum befahl, nur
auf die eigene innere Stimme zu hören [...].
Aus Hafner, G.: Bildlexikon antiker Personen, S. 253f.
| zurück zum Verzeichnis |